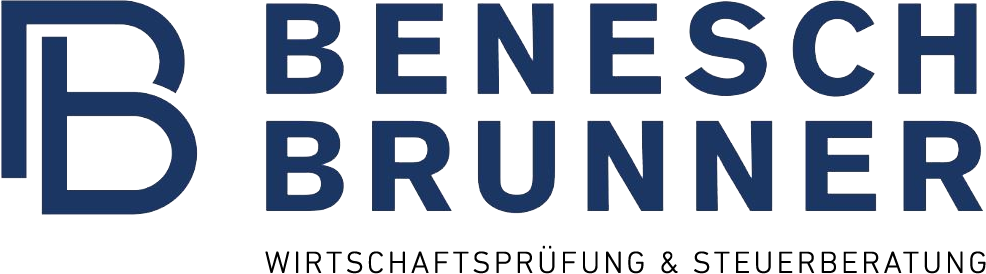Antrag auf Verlängerung der Spendenbegünstigung für Vereine
Für die Spendenbegünstigung von Vereinen sind formelle Voraussetzungen zu erfüllen, insbesondere ist eine bereits bestehende Spendenbegünstigung jährlich zu verlängern.
Spenden spielen für viele gemeinnützige Organisationen eine zentrale Rolle bei der Finanzierung ihrer Tätigkeit. Um für potenzielle Unterstützer attraktiver zu sein, kann es für einen Verein von Vorteil sein, als spendenbegünstigte Einrichtung anerkannt zu werden. Nur wenn eine Organisation spendenbegünstigt ist, können Zuwendungen an sie vom Spender steuerlich geltend gemacht werden.
Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden beim Spender setzt voraus, dass der Empfänger der Spende, also z.B. ein Verein, in die Liste der begünstigten Spendenempfänger eingetragen ist. Diese Eintragung erfolgt auf Grund eines Bescheides des Finanzamts Österreich, in welchem bestätigt wird, dass die betreffende Einrichtung dem begünstigten Empfängerkreis angehört. Die Zuerkennung der Spendenbegünstigung ist von der begünstigten Organisation mittels amtlichem elektronischen Formular zu beantragen. Der Antrag ist bei kleinen Organisationen durch einen berufsmäßigen Parteienvertreter (Steuerberater) über FinanzOnline einzubringen.
Spendenbegünstigung ist jährlich zu verlängern
Die Zuerkennung der Spendenbegünstigung ist jährlich zu verlängern, da es ansonsten zu einem Widerruf durch das Finanzamt kommen kann. Im Rahmen des Gemeinnützigkeitsreformgesetzes 2023 wurde die Spendenbegünstigung für Organisationen, die bereits zum 31.12.2023 spendenbegünstigt waren, für 2024 automatisch verlängert. Diese automatische Verlängerung ist ab 2025 aber nicht mehr vorgesehen, vielmehr müssen die Spendenbegünstigungen jährlich binnen neun Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres der Organisation durch einen berufsmäßigen Parteienvertreter via FinanzOnline verlängert werden. Dies gilt auch für Organisationen, die zum 31.12.2023 bereits auf der Liste der spendenbegünstigten Einrichtungen waren. Die Verlängerung ist daher in der Regel (Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr) bis 30.9. zu beantragen.
Vereinsstatuten, Satzung oder Gesellschaftsvertrag ist beizulegen
Dem Antrag ist die geltende Rechtsgrundlage, also die Vereinsstatuten, die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag der gemeinnützigen Körperschaft, beizulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass diese Rechtsgrundlage immer den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht und alle Inhalte aufweist, die für die Spendenbegünstigung enthalten sein müssen. Bei Körperschaften, die der Pflicht zur gesetzlichen oder satzungsmäßigen Abschlussprüfung durch einen Abschlussprüfer unterliegen, ist zusätzlich jährlich das Vorliegen der Voraussetzungen sowie die Einhaltung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften von einem Wirtschaftsprüfer im Rahmen einer den Anforderungen des Unternehmensgesetzbuches entsprechenden Prüfung zu bestätigen.
Hinweis
Bei Wegfall der Voraussetzungen für die steuerliche Begünstigung oder bei Unterbleiben der fristgerechten Meldung kann die Spendenbegünstigung vom Finanzamt Österreich widerrufen werden. Eine entsprechend frühzeitige Planung der Meldung und Abstimmung mit uns sind daher jedenfalls notwendig. Weiters empfehlen wir die rechtzeitige Prüfung und Anpassung der Statuten, um einem Mängelbehebungsverfahren durch das Finanzamt vorzubeugen.
Abgrenzung zwischen gewillkürtem und notwendigem Privatvermögen
Grundstücke können durch Aufnahme in die Bilanz in das gewillkürte Betriebsvermögen aufgenommen werden, wenn dies dem Betrieb förderlich ist.
In einem Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof (VwGH) ging es darum, ob Grundstücke, die nicht bilanziell dokumentiert wurden, auch als gewillkürtes Betriebsvermögen gelten können, und ob eine private Nutzung automatisch notwendiges Privatvermögen entstehen lässt.
Partei im Verfahren war eine GmbH & Co KG, deren Unternehmensgegenstand unter anderem die Errichtung und den Betrieb von Einkaufszentren umfasst. Im Mittelpunkt des Verfahrens stand die Entnahme einer Liegenschaft aus dem Vermögen der GmbH & Co KG. Diese Entnahme wurde dokumentiert, jedoch blieb die tatsächlich entnommene Fläche sowie der anzusetzende Entnahmewert strittig. Es wurde daher vom Finanzamt und in weiterer Folge auch vom Bundesfinanzgericht (BFG) die Annahme getroffen, dass die gesamte Fläche entnommen wurde. Die GmbH & Co KG erhob dagegen ein Rechtsmittel, da sich nicht die Entnahme der gesamten Fläche aus der Bilanz ableiten ließ und Teilflächen für Zwecke der privaten Erholung und als Garten genutzt wurden und diese daher dem notwendigen Privatvermögen zuzurechnen sind.
Offen blieb damit, in welchem Umfang Betriebsvermögen vorlag und welche steuerlichen Folgen sich aus der Entnahme der betrieblich genutzten Teilgrundstücksflächen ergaben.
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH)
Der VwGH stellte klar, dass Grundstücke unter bestimmten Voraussetzungen als gewillkürtes Betriebsvermögen qualifiziert werden können, wenn sie weder notwendiges Betriebsvermögen noch notwendiges Privatvermögen sind. Der Steuerpflichtige muss hierbei jedoch den Entschluss fassen, diese Grundstücke als gewillkürtes Betriebsvermögen zu behandeln, und dieser dann auch buchmäßig dokumentiert werden.
Die Wirtschaftsgüter müssen zudem in irgendeiner Weise dem Betrieb förderlich sein, etwa durch ein betriebliches Interesse an einer fundierten Kapitalausstattung. Es darf jedoch keine zwingende betriebliche Nutzung der Wirtschaftsgüter vorliegen, da diese dann bereits dem notwendigen Betriebsvermögen zugerechnet werden. Notwendiges Betriebsvermögen ist objektiv erkennbar zum unmittelbaren Einsatz im Betrieb bestimmt und dient diesem auch tatsächlich.
Notwendiges Privatvermögen
Im Gegensatz dazu stellen Wirtschaftsgüter, die objektiv privaten (bzw. gesellschaftsrechtlichen) Zwecken dienen oder objektiv erkennbar für solche Zwecke bestimmt sind, notwendiges Privatvermögen dar. Diese Wirtschaftsgüter können nicht dem gewillkürten Betriebsvermögen zugeordnet werden. Wird ein Grundstück für private Zwecke, wie zur Freizeit, Erholung oder zur Nutzung als Garten verwendet, stellt dies nicht zwingend notwendiges Privatvermögen dar. Die private Nutzung beeinträchtigt die Betriebsvermögensstärkung nicht, wenn das Grundstück Eigenschaften aufweist, die eindeutig dem Unternehmenszweck dienen können und das Wirtschaftsgut in der Bilanz dokumentiert ist.
Im gegenständlichen Fall waren die Grundstücke aufgrund der Größe und Lage durchaus zur Errichtung eines Einkaufszentrums geeignet gewesen. Wird ein Wirtschaftsgut jedoch nicht in die Bilanz aufgenommen, kann es keinesfalls gewillkürtes Betriebsvermögen darstellen.
Fazit
Mit dem ergangenen Erkenntnis wiederholt der VwGH die zentralen Grundsätze der ertragsteuerlichen Behandlung von betrieblich und privat verwendeten Vermögen. Als gewillkürtes Betriebsvermögen gelten jene Wirtschaftsgüter, die weder dem notwendigen Betriebs- noch dem notwendigen Privatvermögen zugeordnet werden können, deren betriebliche Zugehörigkeit jedoch durch den Willen des Steuerpflichtigen – dokumentiert durch die Aufnahme in die Bilanz – begründet wird.
Als Voraussetzung gilt, dass das Wirtschaftsgut dem Betrieb in irgendeiner Weise förderlich ist, etwas durch ein betriebliches Interesse, einer fundierten Kapitalausstattung oder als Erweiterungsfläche. Eine geringfügige Privatnutzung dieser Wirtschaftsgüter begründet nicht zwingend die Zuordnung zum notwendigen Privatvermögen.
Keine Umsatzsteuerpflicht bei Ausbildungskostenrückersatz?
Wird ein Dienstverhältnis durch den Arbeitnehmer beendet, so kann er zur Leistung eines Ausbildungskostenrückersatzes verpflichtet werden. Dieser Kostenrückersatz muss nicht mehr umsatzsteuerpflichtig behandelt werden.
Der geleistete Rückersatz unterlag bisher der Umsatzsatzsteuer, das heißt, der Arbeitgeber musste dem Arbeitnehmer bei Verrechnung des Kostenrückersatzes Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Laut einer Anfragebeantwortung durch das Bundesministerium für Finanzen (BMF) wird diese Rechtsansicht aber nunmehr nicht mehr geteilt.
Ausbildungskostenrückersatz
Arbeitgeber können unter gewissen Voraussetzungen die Kosten für Ausbildungen ihrer Arbeitnehmer bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zurückfordern. Hierbei muss eine auf die konkrete Ausbildungsmaßnahme bezogene Rückzahlungspflicht mit dem Arbeitnehmer vereinbart werden. Die Kosten können dann rückgefordert werden, wenn dem Arbeitnehmer durch die Ausbildung Spezialkenntnisse theoretischer oder praktischer Art vermittelt werden. Diese Kenntnisse müssen in einem anderen Unternehmen bzw. bei einer selbstständigen Erwerbstätigkeit einsetzbar sein und zusätzlich dem Arbeitnehmer objektiv bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen.
Der Arbeitgeber kann, sofern dies vereinbart wurde, dann vor allem Kursgebühren, Reisekosten und Lohnkosten während der Ausbildung vom Arbeitnehmer zurückfordern. Letztlich setzt die Rückforderung eine durch den Arbeitnehmer verursachte Beendigung des Arbeitsverhältnisses innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nach der erfolgten Ausbildung voraus. Der Zeitraum muss hierbei angemessen sein und darf im Normalfall nur maximal vier Jahre betragen. Der Rückzahlungsbetrag vermindert sich monatlich und linear mit dem Verstreichen der Bindungsdauer.
Aus umsatzsteuerlicher Sicht unterlag bisher die Rückerstattung von Ausbildungskosten der Umsatzsteuerpflicht. Dies geht aus der zuvor ergangenen Rechtsprechung hervor, da ein Leistungsaustausch zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer vorliegt. Der Arbeitnehmer erhält eine Ausbildung und der Arbeitgeber ein Entgelt für eine Sachleistung. Die Kompensationszahlung des Arbeitnehmers gilt nicht als (echter) Schadenersatz. Für den Arbeitnehmer erhöhte sich die Rückzahlung um den Betrag der Umsatzsteuer.
Nicht steuerbarer Schadenersatz
In einer Anfrage an das BMF ging es darum, ob es bei nicht vorsteuerabzugsberechtigten Arbeitgebern (z.B. einer Bank) zu einer Doppelbesteuerung im Zusammenhang mit einem Ausbildungskostenrückersatz kommt, da der Arbeitgeber keinen Vorsteuerabzug für die Ausbildung geltend machen kann, aber beim Ausbildungskostenrückersatz dennoch Umsatzsteuer verrechnen und abführen muss. Das BMF hält dazu fest, dass bei einem aufgrund einer Kündigung zu zahlenden Ausbildungskostenrückersatz kein direkter Zusammenhang zwischen der Zahlung des Rückersatzes und einer Leistung des Arbeitgebers gegeben ist. Vielmehr handelt es sich hierbei um einen nicht steuerbaren Schadenersatz. Echter Schadenersatz wird auf Grund einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung, für einen Schaden einstehen zu müssen, geleistet.
Anmerkung
Die Beantwortung des BMF kommt zu einem überraschenden Ergebnis, welches der bisherigen Rechtsprechung widerspricht. Da eine Anfragebeantwortung des BMF keine gesetzliche Bindung entfaltet, sondern lediglich die Ansicht der Finanzverwaltung widerspiegelt, sollte die BMF-Information kritisch betrachtet werden. Das Bundesfinanzgericht muss nämlich nicht der Ansicht der Finanzverwaltung folgen.
Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Fristversäumnis durch Urlaub
Ein Urlaub entbindet nicht von der Pflicht, für eine ordnungsgemäße Vertretung und eine Fristenkontrolle zu sorgen.
Wird von einem Steuerpflichtigen oder dessen Vertreter eine Frist, wie etwa eine Beschwerdefrist, versäumt, ist auf Antrag des Steuerpflichtigen bzw. des Vertreters die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu bewilligen, wenn er glaubhaft macht, dass er durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert war, die Frist einzuhalten.
Urlaubsbedingt abwesend
In einem Fall hatte ein Rechtsanwalt einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt, nachdem eine Frist zur Stellung eines Vorlageantrags gegen eine Beschwerdevorentscheidung des Finanzamts versäumt wurde, da die Beschwerdevorentscheidung um drei Tage zu spät eingebracht wurde. Dazu kam es durch einen einmaligen unvorhersehbaren Fehler einer sonst sehr zuverlässigen Kanzleikraft. Im ursprünglichen Wiedereinsetzungsantrag wurde jedoch keine Organisationspflichtverletzung dargelegt.
Erst im Zuge der Beschwerde wurde angeführt, dass die Kanzleikraft über ausreichende Fachkenntnisse verfüge, um Fristen selbst zu berechnen und korrekt in den Fristenkalender sowie in den Handakt einzutragen. Diese Eintragungen wurden auch laufend überprüft. Der Fehler sei aber nicht aufgefallen, weil der für die Kontrolle zuständige Anwalt während der Fristeintragung urlaubsbedingt abwesend war und ihm der Handakt daher nicht vorgelegt wurde.
Entscheidung des Bundesfinanzgerichtes (BFG)
Das BFG wies den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ab. Das Fristversäumnis wurde im Wiedereinsetzungsantrag zunächst ausschließlich mit einem einmaligen Versehen einer ansonsten zuverlässigen Kanzleikraft begründet. Ein Vorbringen zur fehlenden Organisationspflichtverletzung des Rechtsanwalts erfolgte jedoch erst bei der Bescheidbeschwerde. Eine derartige Auswechslung des Wiedereinsetzungsgrundes im Rechtsmittelverfahren ist unzulässig. Das Vorbringen war daher nicht zu berücksichtigen, sodass der Antrag bereits aus diesem Grund als unbegründet abzuweisen war.
Außerdem sah das BFG auch inhaltlich keinen Wiedereinsetzungsgrund als gegeben an. Soweit der Antragsteller seine urlaubsbedingte Abwesenheit als Grund der Fristversäumnis anführte, stellte das Gericht klar, dass ein Urlaub ein planbares und vorhersehbares Ereignis darstellt. Ein Rechtsanwalt ist verpflichtet, während seiner Abwesenheit für eine angemessene Vertretung und Kontrolle seiner Kanzleiabläufe zu sorgen. Ein diesbezügliches Organisationsverschulden ist dem Rechtsanwalt zuzurechnen und schließt eine Wiedereinsetzung aus.
Fazit
Das Erkenntnis des BFG zeigt die strengen Anforderungen an die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand auf. Wesentlich ist, dass die Gründe für die Fristversäumnis bereits im Wiedereinsetzungsantrag vollständig dargelegt werden. Darüber hinaus entbindet ein Urlaub einen Rechtsanwalt nicht von seiner Organisationspflicht. Wer während seiner Abwesenheit nicht für eine funktionierende Kanzleivertretung sorgt, handelt schuldhaft.
Feiertagsarbeitsentgelt und Zuschläge
Wird ein Arbeitnehmer trotz Feiertagsruhe beschäftigt, hat er zusätzlich Anspruch auf ein Feiertagsarbeitsentgelt. Das Bundesfinanzgericht BFG stellte nun klar, dass ein derartiges Feiertagsarbeitsentgelt nicht steuerfrei abgerechnet werden kann, soweit es keinen darüber hinausgehenden Zuschlag für das Arbeiten an einem Feiertag beinhaltet.
Das Finanzministerium hat nun eine diesbezügliche Information veröffentlicht. Für Zulagen und Zuschläge sind im Einkommensteuerrecht unter Umständen spezielle Begünstigungen vorgesehen. Zuschläge für „Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit“ sind insgesamt bis zu € 400 pro Monat für Dienstnehmer steuerfrei. In der Vergangenheit gingen Arbeitgeber davon aus, dass auch das Feiertagsarbeitsentgelt an sich - wie die Zuschläge - steuerfrei belassen werden kann. Diese Auslegung wurde jedoch nie einheitlich vertreten.
Das Bundesfinanzgericht (BFG) hat nun entgegen dieser Praxis entschieden, dass der Grundstundenlohn für an Feiertagen geleistete Arbeit kein derartig steuerfrei gestellter Zuschlag ist. Unter „Zuschläge“ wird nach dem BFG nur der zusätzliche Lohnbestandteil zum Grundentgelt verstanden. Mit einer Anfragebeantwortung schuf nun auch das BMF diesbezüglich Klarheit.
Feiertagsarbeitsentgelt kein steuerfreier Zuschlag
Das BMF teilt die Rechtsansicht des BFG, dass das sogenannte Feiertagsarbeitsentgelt keinen steuerfreien Zuschlag darstellt. Wird ein zusätzliches Entgelt für die an Feiertagen tatsächlich geleistete Arbeit bezahlt, jedoch kein darüberhinausgehender Zuschlag, dann liegt kein steuerfreier Zuschlag für Feiertagsarbeit vor. Denn bereits die Bedeutung des Wortes Zuschlag, mit dem ein zusätzlicher Lohnbestandteil vorausgesetzt wird, macht deutlich, dass das Tatbestandsmerkmal des Vorliegens einer Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit für sich allein noch nicht dazu führt, dass ein Teil des für solche Arbeiten bezahlten Lohnes steuerfrei ist. Vielmehr muss die Art der Entlohnung darauf schließen lassen, dass in ihr tatsächlich Zuschläge der genannten Art enthalten sind.
Eine im Sinne der früheren Auslegung begünstigte Behandlung des für die an Feiertagen geleistete Arbeit gebührenden Entgelts ist daher allenfalls bis zum 31.12.2024 möglich. Ab dem 1.1.2025 muss dieses Entgelt verbindlich als steuerpflichtig abgerechnet werden, nur ein gesonderter Feiertagszuschlag kann steuerfrei geleistet werden.
Fazit
Echte Zuschläge zum Feiertagsarbeitsentgelt, welche über den Grundstundenlohn hinausgehen, sind steuerlich begünstigt. Ein derartiger Zuschlag muss jedoch klar am Lohnzettel ausgewiesen werden.
Jahresboni, Rabatte & Co
Insbesondere im Handelsbereich sind Jahresboni, Rabatte und andere Preisnachlässe gängige Marketing-Instrumente, die Unternehmen von ihren Lieferanten erhalten. Diese Preisnachlässe sind umsatzsteuerlich korrekt zu behandeln und Besonderheiten zu beachten.
In der Umsatzsteuer ist zwischen einer Entgeltminderung durch den Lieferanten und sonstigen Leistungen des Abnehmers an den Lieferanten zu unterscheiden. Eine Entgeltminderung liegt vor, wenn es von Seiten des Lieferanten zu einer nachträglichen Reduktion der ursprünglich vereinbarten Gegenleistung (des Entgelts) kommt, etwa in Form eines Rabattes, Skontos oder eines Jahresbonus. Charakteristisch ist dabei der unmittelbare Zusammenhang dieser Entgeltminderung mit dem Grundgeschäft, also zur ursprünglichen Lieferung oder sonstigen Leistung des Lieferanten. Diese Minderung wirkt sich direkt auf die Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer aus, diese ist entsprechend zu berichtigen.
In der Praxis von Handelsunternehmen spielen vor allem Rabatte eine bedeutende Rolle. Rabatte sind Preisnachlässe, die der Unternehmer dem Abnehmer auf den allgemeinen Preis gewährt. Rabatte führen zu einer Minderung der Bemessungsgrundlage, wenn sie nachträglich gewährt oder in Anspruch genommen werden. Hat sich die Bemessungsgrundlage geändert, so hat einerseits der Unternehmer, der den Umsatz ausgeführt hat, den dafür geschuldeten Umsatzsteuerbetrag zu berichtigen. Andererseits muss auch der Unternehmer, an den der Umsatz ausgeführt worden ist, den in Anspruch genommenen Vorsteuerabzug korrigieren.
Sonstige Leistungen des Abnehmers
Sonstige Leistungen des Abnehmers der Ware an den Lieferanten der Ware hingegen stehen nicht in direktem Zusammenhang mit dem Grundgeschäft. Sie stellen eigenständige Leistungen dar, zum Beispiel im Fall von Marketingmaßnahmen, die der Abnehmer der Ware für den Lieferanten erbringt, wie etwa besondere Kennzeichnung oder Präsentation der Ware des Lieferanten im Geschäft des Abnehmers (z.B. eines Lebensmittelhändlers). In solchen Fällen liegt regelmäßig eine eigenständige Leistung des Abnehmers an den Lieferanten mit einer eigenen umsatzsteuerlichen Beurteilung vor. Dabei ist insbesondere auf den jeweils anzuwendenden Steuersatz zu achten. So unterliegt z.B. ein Milchproduzent einem Steuersatz iHv 10%, während die Marketingleistung des Lebensmittelhändlers mit 20%iger Umsatzsteuer zu versteuern ist.
Hinweis
Nicht zu vergessen ist die richtige Erfassung der Vorgänge in der Buchhaltung. Hier kommt es auf den Einzelfall an, ob eine Aufwandsminderung oder ein Erlös vorliegt. Aufgrund der komplexen Umsatzsteuer-Regelungen, die darüber hinaus regelmäßig adaptiert werden, sind eine laufende steuerliche Beratung und entsprechende Betreuung unerlässlich.
Änderungen in der Grunderwerbsteuer - Einführung Umwidmungszuschlag
Der Nationalrat hat die Ausweitung der Grunderwerbsteuerpflicht und die Einführung eines Umwidmungszuschlags beschlossen. Die neuen Regelungen treten bereits ab 1.7.2025 in Kraft.
Grunderwerbsteuer
Ein zentraler Schwerpunkt im Bereich der Grunderwerbsteuer ist die Gleichstellung von Asset-Deals und Share-Deals bei Transkationen, die Personen- und Kapitalgesellschaften mit inländischen Grundstücken im Vermögen betreffen. Während bei einem Share-Deal Anteile an einer Gesellschaft übertragen werden, werden bei einem Asset-Deal einzelne Wirtschaftsgüter wie z.B. Grundstücke veräußert.
Bei Personengesellschaften fällt derzeit Grunderwerbsteuer an, wenn innerhalb von 5 Jahren 95% der Anteile auf neue Gesellschafter übergehen. Diese Regelung wurde auf Kapitalgesellschaften ausgeweitet und die Frist von 5 Jahren auf 7 Jahre angehoben.
Bisher fällt bei einem Share-Deal auch Grunderwerbsteuer an, wenn mindestens 95% der Anteile an einer grundstücksbesitzenden Gesellschaft in einer Hand vereinigt werden. Künftig wird dieser Schwellenwert auf 75% reduziert. Zudem können auch mittelbare Anteilserwerbe an grundstücksbesitzenden Gesellschaften Grunderwerbsteuer auslösen. Zur Ermittlung der mittelbaren Beteiligungshöhe werden die prozentuellen Beteiligungen auf jeder Ebene miteinander multipliziert. Ergibt die Berechnung eine mittelbare Beteiligung von 75% oder mehr, wird ein grunderwerbsteuerpflichtiger Tatbestand ausgelöst. Künftig spielt für die Definition „Vereinigung in einer Hand“ die Unternehmensgruppe keine Rolle mehr; es wird vielmehr auf eine Erwerbergruppe abgestellt. Bei Umstrukturierungen innerhalb eines Konzerns sind diesbezüglich Ausnahmen vorgesehen.
Erhöhung des Steuersatzes und der Bemessungsgrundlage
Ein weiterer Punkt ist die Erhöhung des Steuersatzes und der Bemessungsgrundlage bei Anteilsübertragungen und Umgründungen im Zusammenhang mit Immobiliengesellschaften. Immobiliengesellschaften sind Gesellschaften, deren Schwerpunkt in der Veräußerung, Vermietung und Verwaltung von Grundstücken liegt. Die Grunderwerbsteuer wird bei Transaktionen solcher Gesellschaften von 0,5% des Grundstückswertes auf 3,5% des gemeinen Wertes (= Verkehrswert) angehoben. Bei Nicht-Immobiliengesellschaften bleibt die Grunderwerbsteuer unverändert bei 0,5% des Grundstückswertes. Ausgenommen von der Erhöhung sind auch grundstücksbesitzende Gesellschaften, wenn alle beteiligten Gesellschafter vor und nach einer Anteilsübertragung/-vereinigung (oder Umgründung) dem begünstigten Personenkreis (Familienverband) angehören.
Umwidmungszuschlag bei der Immobilienertragsteuer (ImmoESt)
Künftig sollen Veräußerungsgewinne höher mit ImmoESt besteuert werden, wenn Grundstücke veräußert werden, die z.B. von Grünland in Bauland umgewidmet wurden. Den Gewinnen aus der Veräußerung des umgewidmeten Grund und Bodens (nicht aber Gebäudes) wird zukünftig ein Umwidmungszuschlag von 30% hinzugerechnet. Der Umwidmungszuschlag ist nur insoweit zu berücksichtigen, als die Summe aus Veräußerungsgewinn und Umwidmungszuschlag den Veräußerungserlös nicht übersteigt (Deckelung). Die Neuregelung gilt für Veräußerungen nach dem 30.6.2025, sofern die Umwidmungen nach dem 31.12.2024 erfolgt sind.
NoVA-Befreiung für leichte Nutzfahrzeuge
Im Zuge des Entlastungspakets für Klein- u. Mittelbetriebe wurde vom Nationalrat am 16.6.2025 die Abschaffung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) für leichte Nutzfahrzeuge der Klasse N1 mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen ab 1.7.2025 beschlossen.
Normverbrauchsabgabe (NoVA)
Die Normverbrauchsabgabe ist eine einmalig zu entrichtende Steuer, die derzeit unter anderem bei der Lieferung oder der erstmaligen Zulassung von Personenkraftfahrzeugen (Klasse M1), Motorrädern (Klasse L) und Nutzfahrzeugen bis 3500 kg (Klasse N1) anfällt. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Kaufpreis, der Leistung des Fahrzeuges und dem Emissionsausstoß. Grundsätzlich gilt: Je teurer das Fahrzeug und je mehr Emissionen ausgestoßen werden, desto höher ist die Normverbrauchsabgabe.
Befreiung von Kraftfahrzeugen der Klasse N1
Ab 1.7.2025 werden nur noch Fahrzeuge, die zur „hauptsächlichen“ Personenbeförderung dienen, der Normverbrauchsabgabe unterworfen. Klassische Transporter, Kastenwagen oder Pritschenwagen mit einer Sitzreihe werden hingegen von der Abgabe befreit. Die Befreiung für Kasten- und Pritschenwägen (hierunter fallen auch Pick-ups) mit zwei Sitzreihen gilt hingegen nur, wenn der Laderaum oder die Ladefläche in ihrer Beschaffenheit bzw. Größe spezifischen Anforderungen genügt. Weiters gilt die Befreiung bei einem Pritschenwagen mit zwei Sitzreihen nur, wenn er über eine einfache Ausstattung verfügt, wobei der Begriff der “einfachen Ausstattung” vom Finanzministerium noch näher zu erläutern sein wird.
Vorführkraftfahrzeuge und Tageszulassungen der Klasse N1
Auch Vorführkraftfahrzeuge von Fahrzeugen der Klasse N1 unterliegen nach der neuen Gesetzesinitiative nicht mehr der NoVA-Pflicht. Dabei ist folgendes zu beachten: Wird ein solcher Klein-LKW als Vorführwagen auf den Autohändler zugelassen, gibt es schon bisher eine NoVA-Befreiung. Erst im Zeitpunkt der Zulassung eines Vorführwagens auf einen Endkunden wird geprüft, ob NoVA-Pflicht besteht. Wird daher ein Vorführfahrzeug der Klasse N1 ab dem 1.7.2025 an einen Kunden verkauft und auf diesen zugelassen, fällt keine NoVA mehr an.
Bei Tageszulassungen der Klasse N1 (Zulassung auf den Fahrzeughändler, keine Verwendung auf öffentlichen Straßen) ist der Zeitpunkt, in dem ein NoVA-pflichtiger Vorgang entsteht, zu beachten. Tageszulassungen sind von der NoVA grundsätzlich befreit, wenn die Zulassung auf einen Fahrzeughändler erfolgt und diese nicht länger als drei Monate dauert. Läuft die dreimonatige Frist vor dem 1.7.2025 ab, ohne dass das Fahrzeug abgemeldet wurde, entsteht die Pflicht zur Entrichtung der NoVA, wobei in diesem Fall der spätere Verkauf an den Endkunden keine weitere NoVA verursacht. Endet die dreimonatige Frist nach dem 1.7.2025, ist keine Abmeldung notwendig und das leichte Nutzfahrzeug unterliegt auch beim Verkauf nicht mehr der NoVA.
Fazit
Die beschlossene Befreiung für Klein-LKW (Kraftfahrzeuge der Klasse N1) ab 1.7.2025 führt dazu, dass die Anschaffung dieser Fahrzeuge erheblich günstiger wird. Auch bei Vorführfahrzeugen dieser Fahrzeugklasse fällt bei der Veräußerung bzw. Lieferung künftig keine NoVA mehr an. Bei Tageszulassungen gilt eine Sonderregelung, nach der eine Steuerpflicht dann noch entsteht, wenn die relevante dreimonatige Frist vor dem 1.7.2025 abgelaufen ist.